Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.
Finanzvermögen: Starkes Wachstum
Trotz geopolitischer Herausforderungen war 2024 ein weiteres Jahr soliden Wachstums für die Weltwirtschaft (+2,8 %). Die US-Wirtschaft stellte erneut ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis, was vor allem auf einen robusten privaten Konsum zurückzuführen war. Dagegen sahen sich Europa und China mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert, die ihre Wirtschaft ausbremsten. Außerdem kam die Wirkung der früheren Zinserhöhungen im Jahr 2024 zum Tragen: In den meisten Regionen ging die Inflation zurück und näherte sich bis zum Jahresende dem Zielwert von 2,0 %. Dadurch konnten die Zentralbanken ihre Zinsen wieder lockern. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) senkten ihre Leitzinsen um jeweils 100 Basispunkte (Bps). Aufgrund der zunehmenden Sorgen über die unaufhörlich steigende Staatsverschuldung folgten die langfristigen Zinsen diesem Trend jedoch nicht. In Europa wie auch den USA stiegen die Staatsanleiherenditen.
Wie schon 2023 verzeichneten die Aktienmärkte im Jahr 2024 hohe Zugewinne. Die Zinssenkungen der Zentralbanken und die anhaltende KI-Euphorie sorgten für Kursauftrieb. Am Jahresende verhalf die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten den Märkten zu zusätzlichem Rückenwind. So legten US-Aktien (S&P 500) im Jahr 2024 um 23,3 % zu und selbst deutsche Aktien (DAX) brachten es auf ein Plus von 18,8 %, obwohl die deutsche Wirtschaft wieder schrumpfte.
Vor diesem Hintergrund stieg auch das Geldvermögen der globalen privaten Haushalte deutlich an. Mit einem Plus von 8,7 % wuchs es sogar noch schneller als im Vorjahr (+8,0 %). Ende 2024 belief sich das weltweite private Finanzvermögen auf insgesamt 269 Billionen Euro (Abbildung 1). Auch wenn das ein neuer absoluter Rekord ist, liegt das Finanzvermögen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung mit 283 % nur auf dem Niveau von 2017. Grund dafür ist der starke Anstieg der Inflation in den vergangenen Jahren, der den Nenner „künstlich“ aufgebläht hat.
Bruttogeldvermögen in Billionen Euro und Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (zum Euro-Wechselkurs Ende 2024)
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.
Die USA halten ihre Spitzenstellung
Bruttogeldvermögen, regionale Aufteilung 2004 (innen) und 2024 (außen) in % (zum Euro-Wechselkurs Ende 2024)
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.
¹ Die Region Nordamerika ist praktisch deckungsgleich mit den USA. Kanadas Anteil an der Region beträgt weniger als 6 % (2024). Die USA ohne Kanada haben einen Anteil von 46,7 % am globalen Finanzvermögen. Im Jahr 2004 waren es noch 49,3 %.
Die weitgehende Stabilität des amerikanischen Anteils am weltweiten Finanzvermögen bedeutet, dass das Wachstum des Geldvermögens der US-Haushalte in den vergangenen 20 Jahren dem globalen Durchschnitt entsprach. Im Jahr 2024 wuchs es jedoch deutlich schneller. Ganz anders sah es in Westeuropa und Japan aus: Hier blieb das jährliche Wachstum des Geldvermögens um mehr als 2 Prozentpunkte beziehungsweise knapp 4 Prozentpunkte hinter dem weltweiten Durchschnitt zurück (Abbildung 3). Bei Bereinigung um Inflation und Bevölkerungswachstum ergibt sich ein ähnliches Bild (siehe Kasten: „Die Auswirkungen der Inflation“). Zusammen mit der schieren Höhe des amerikanischen Geldvermögens bedeutet dies, dass 2024 mehr als die Hälfte (53,6 %) des globalen Vermögenswachstums auf Nordamerika entfiel. Im Durchschnitt der vergangenen zwei Jahrzehnte waren es 48,5 %, während China und Westeuropa für 19,8 % beziehungsweise 14,1 % des Wachstums des globalen Geldvermögens verantwortlich waren. Was den finanziellen Wohlstand angeht, bleiben die USA der unangefochtene Spitzenreiter.
Dass das Geldvermögen in den USA schneller wächst als im weltweiten Durchschnitt ist ein relativ neues Phänomen (mit Ausnahme des besonders schwierigen Jahres 2022). In früheren Jahren – vor allem nach der globalen Finanzkrise – hinkten die USA deutlich hinterher. Der Wendepunkt lässt sich ziemlich genau auf das Jahr 2017 datieren, das erste Jahr der Amtszeit von Präsident Trump, als die Handelskonflikte zwischen den USA und China offen zutage traten und das Ende der stetig voranschreitenden Globalisierung und immer stärkeren Integration der Schwellenländer in die globale Arbeitsteilung einläuteten. Seither ist der Wachstumsvorsprung der Schwellenländer gegenüber den Industrieländern deutlich geschrumpft. Im Jahr 2024 dürfte er zwar wieder auf 4 Prozentpunkte angestiegen sein – das vergleicht sich jedoch mit einem durchschnittlichen Wachstumsabstand von knapp 14 Prozentpunkten in den zehn Jahren vor 2017 (Abbildung 4): Der Konvergenzprozess zwischen reicheren und ärmeren Ländern ist in einer zunehmend fragmentierten Weltwirtschaft ins Stocken geraten.

Bruttogeldvermögen, durchschnittliches jährliches Wachstum 2005-2024 und Wachstum 2024/2023, in %
* Gesamte jährliche Wachstumsrate, 2024 EUR.
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.
Veränderung des Bruttogeldvermögens gegenüber dem Vorjahr in % (zum Euro-Wechselkurs Ende 2024)
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.

Die Dominanz der USA zeigt sich auch im Pro-Kopf-Geldvermögen, zumindest wenn man die Durchschnittswerte betrachtet: Danach sind nur die Schweizer noch reicher als die Amerikaner. Alle anderen Länder folgen mit deutlichem Abstand (Abbildung 5).
Während die beiden Spitzenplätze seit Jahren in fester Hand sind, gab es unter den Top 10 zuletzt einige Veränderungen. So gehörten Taiwan, Schweden und Australien diesem illustren Kreis vor zwei Jahrzehnten noch nicht an – dafür waren Belgien, Großbritannien und Japan damals noch in den Top 10. Mit den Niederlanden ist das reichste Land der Eurozone seit 2004 von Platz 3 auf Platz 8 abgerutscht. Mit Blick auf Deutschland ist anzumerken, dass der Aufstieg von Platz 17 auf Platz 15 in diesem Jahr auf eine umfassende Datenrevision zurückzuführen ist, die zu einer deutlich höheren Bewertung nicht börsennotierter Aktienbeteiligungen geführt hat. Damit ist Deutschland – neben den baltischen Staaten und Malta – eines der wenigen Länder der Eurozone, die ihr Ranking in den letzten Jahren verbessern konnten. Und China? Es liegt jetzt auf Platz 31 und hat sich damit gegenüber 2004 um neun Plätze verbessert.
Bruttogeldvermögen pro Kopf in Euro (zum Euro-Wechselkurs Ende 2024)
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.

Die Auswirkungen der Inflation
Bruttogeldvermögen pro Kopf, nominales und reales durchschnittliches jährliches Wachstum 2005-2024, in %
* Gesamte jährliche Wachstumsrate, 2024 EUR.
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.
Wirklich schmerzhaft wurde die Inflation jedoch erst nach der Pandemie, als sie in Teilen Europas zweistellige Werte erreichte. Davon hat sich der Kontinent immer noch nicht erholt. Im Jahr 2024 dürfte das reale Geldvermögen in Westeuropa um 2,4 % unter dem Niveau von 2019 gelegen haben. Mit einem realen Wachstum von 16 % in den letzten fünf Jahren ist der globale Trend etwas positiver. Auch auf globaler Ebene liegt das reale Geldvermögen jedoch immer noch unter dem Niveau von 2021 (Abbildung 7).
Dabei gibt es bedeutende regionale Unterschiede. Dank relativ niedriger Inflationsraten verzeichnete Asien (ohne Japan und China) in den vergangenen fünf Jahren ein starkes reales Wachstum. Ende 2024 lag das reale Geldvermögen hier um 29 % über dem Wert von 2019. Noch beeindruckender ist das Wachstum in China mit 56 %. In Japan (+9 %) und Nordamerika (+14 %) fiel das Wachstum dagegen bescheidener aus. Anders als Westeuropa haben diese Regionen jedoch reale Wohlstandsgewinne verzeichnet. Tatsächlich ist Westeuropa die einzige Region, die auf fünf verlorene Jahre zurückblickt.
Bruttogeldvermögen, nominale versus reale Entwicklung (indexiert, 2019=100) und durchschnittlicher Verbraucherpreisindex (VPI) 2020-2024 in %
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.

Clevere Sparer
Was sind die Gründe für die so unterschiedliche Entwicklung der Geldvermögen? Am besten lässt sich diese Frage beantworten, indem man den Anstieg des Geldvermögens in seine beiden Komponenten herunterbricht: Ersparnisse und Wertgewinne.
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Wertgewinne. Es sind in erster Linie Wertpapiere, insbesondere Aktien, die zu einem Anstieg des Portfoliowerts führen. In dieser Hinsicht waren die letzten beiden Jahre für Sparer äußerst erfreulich, da ihnen der anhaltende Aktienmarktboom starke Wertgewinne beschert hat. Dies zeigt sich auch in den sehr unterschiedlichen Wachstumsraten der drei wichtigsten Vermögensklassen: Bankeinlagen, Wertpapiere (einschließlich Investmentfonds) und Versicherungen/Pensionen (Abbildung 8). Sowohl 2023 (+11,5 %) als auch 2024 (+12,0 %) wuchs das Wertpapiervermögen fast doppelt so schnell wie die beiden anderen Vermögensklassen: Versicherungen/Pensionen (+6,7 % bzw. +6,9 %) und Bankeinlagen (+4,7 % bzw. +5,7 %). Dieser Wachstumsvorteil bleibt auch langfristig bestehen, wenn auch weniger ausgeprägt, da die Aktienmärkte nicht nur gute Jahre erleben. Dennoch haben Wertpapiere in den letzten 20 Jahren durchschnittliche Wertgewinne von 6,9 % erzielt, was deutlich über dem Wertzuwachs des gesamten Geldvermögens (+6,1 %) liegt.
Veränderung des Bruttogeldvermögens gegenüber dem Vorjahr in % (zum Euro-Wechselkurs Ende 2014)
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.
Um von einer positiven Börsenentwicklung zu profitieren, müssen Anleger die entsprechenden Wertpapiere jedoch erst einmal in ihren Portfolios haben. Tatsächlich sind Wertpapiere die bei Weitem wichtigste Vermögensklasse. Ende 2024 machten sie 45,1 % des globalen Geldvermögens aus. Das ist ein neuer Rekord. Trotz einiger Rückschläge an der Börse haben Aktien, Investmentfonds und andere Wertpapiere über die vergangenen zwei Jahrzehnte kontinuierlich an Bedeutung gewonnen: Insgesamt ist ihr Anteil an den Portfolios im Vergleich zu 2004 um fast 7 Prozentpunkte gestiegen. Dagegen ist der Anteil von Versicherungen/Pensionen im gleichen Zeitraum um knapp 7 Prozentpunkte auf 25,8 % gesunken – auch das ist ein neuer „Rekord“. Der Anteil der Bankeinlagen hat sich leicht auf 26,7 % erhöht (Abbildung 9).
Diese globalen Zahlen verschleiern große Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern und Regionen und damit das Ausmaß, in dem Sparer von steigenden Wertpapierkursen profitieren. Auffällig ist, dass vor allem nordamerikanische Sparer in Wertpapiere investieren. Im Schnitt machen diese 59,2 % ihrer Portfolios aus. Das war nicht immer so: Nach der globalen Finanzkrise fiel dieser Wert auf unter 46 %. Auch in Südamerika haben Wertpapiere eine überproportionale Bedeutung, wobei es sich hier eher um andere Beteiligungen als börsennotierte Aktien handelt. In Asien hingegen spielen Wertpapiere im Allgemeinen nur eine untergeordnete Rolle, was vor allem an den unterentwickelten Finanzmärkten der Region liegen dürfte. Das erklärt auch die große Bedeutung von Bankeinlagen in der Region (wie auch in Osteuropa). Dieses Argument trifft jedoch sicherlich nicht auf Australien zu, wo viele Sparer über Rentenprodukte (sogenannte Superannuations) indirekt am Kapitalmarkt investiert sind. Westeuropa dagegen zeichnet sich durch eine ausgewogene Portfoliozusammensetzung aus, wobei Wertpapiere hier deutlich weniger wichtig sind als in Nordamerika.
Diese unterschiedlichen Portfoliostrukturen verdeutlichen die große Vielfalt des weltweiten Sparverhaltens. Sie erklären auch, warum es nordamerikanischen Sparern im Gegensatz zu Sparern in Japan und Europa gelungen ist, ihr Geldvermögen in den letzten Jahren im Einklang mit den globalen Entwicklungen zu steigern – obwohl das bereits sehr hohe Ausgangsniveau hier eigentlich für ein schwächeres Wachstum sprechen würde, wie es auch in anderen entwickelten Regionen zu beobachten ist.

Bruttogeldvermögen nach Vermögensklassen in % (zum Euro-Wechselkurs Ende 2024)
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.

Harte Sparer2
Im Jahr 2024 erhöhten sich die frischen Spargelder (Neuanlage) der globalen Privathaushalte um fast 35 % auf insgesamt 4,2 Billionen Euro (Abbildung 10). Damit reichten diese zwar noch lange nicht an die Spitzenwerte der Ausnahmejahre 2020 und 2021 heran, der Abwärtstrend der beiden Vorjahre wurde aber ganz klar gestoppt. In allen hier betrachteten Regionen stiegen die Neuanlagen, wobei Nordamerika mit über 39 % das stärkste Wachstum verzeichnete. Auf diese Region entfiel mehr als die Hälfte der frischen Spargelder in Höhe von insgesamt 2,3 Billionen Euro.
Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung war die kräftige Erholung der Bankeinlagen. Im Jahr 2024 flossen den Banken 28 % der frischen Spargelder zu, nachdem sie im Vorjahr per Saldo leer ausgegangen waren, was vor allem am Verhalten der amerikanischen Sparer lag. Im Jahr 2023 hatten diese 500 Milliarden Euro aus Bankeinlagen abgezogen und in höher rentierliche Anlagewerte, vor allem Anleihen, investiert. Im Jahr 2024 war der Anteil der Bankeinlagen an den Mittelzuflüssen zwar deutlich höher als in den beiden Vorjahren, aber immer noch weit vom Niveau der Vor-Corona-Jahre entfernt, als er im Schnitt bei über 40 % lag. Die Rückbesinnung auf Bankeinlagen dürfte daher auch weniger mit ihrer Attraktivität an sich zu tun haben als damit, dass die Opportunitätskosten des Parkens von Spargeldern auf Geldkonten in einem Umfeld sinkender Zinsen niedriger waren. Die Entwicklung in Japan bestätigt dies: Hier führte die späte Zinswende dazu, dass der Anteil der Bankeinlagen an den frischen Spargeldern auf ein Allzeittief von 25 % fiel.
Nach den Höchstständen der Vorjahre erlitt das Wertpapiersparen im vergangenen Jahr einen leichten Rückschlag. Die Nettokäufe von Anleihen, Aktien und Investmentfonds gingen um 11,9 % zurück, erreichten mit insgesamt 2,0 Billionen Euro nach dem Rekordjahr 2023 aber trotzdem den zweithöchsten je verzeichneten Wert. Mehr als drei Viertel dieser Käufe wurden von amerikanischen Sparern getätigt. Wie erwartet, verschoben sich die Präferenzen erneut. Anleihen waren kaum gefragt und machten weniger als 4 % der Wertpapierkäufe aus. Amerikanische Sparer waren sogar Nettoverkäufer von Zinspapieren, nachdem sie ihre Anleiheportfolios im Jahr 2023 um über 1 Billion Euro aufgestockt hatten. Nur die japanischen und italienischen Privatanleger blieben der Anlageklasse treu. Während japanische Sparer mehr Anleihen erwarben, zeigten sich italienische Sparer deutlich zurückhaltender als im Vorjahr, kauften im Jahr 2024 aber trotzdem erheblich mehr Anleihen als alle anderen Europäer.
Aktien waren im letzten Jahr noch stärker gefragt als im Vorjahr. Mit 818 Milliarden Euro erreichten die Aktienkäufe einen neuen Rekordwert, der nur vom Ausnahmejahr 2021 übertroffen wurde. Für diesen Anstieg waren ausschließlich die amerikanischen Sparer verantwortlich; in allen anderen Regionen wurden unter dem Strich Aktien verkauft (wenn auch nur in sehr begrenztem Umfang). Dagegen verzeichneten Investmentfonds überall starke Zuflüsse. Insgesamt erreichten die Anlagen frischer Spargelder in Investmentfonds 1,1 Billionen Euro (+19,7 %), was in etwa dem Niveau von 2021 entsprach. Der Siegeszug der börsengehandelten Fonds (ETFs) dürfte einer der Hauptgründe für diese Entwicklung sein.
Auch Versicherungen/Pensionen stiegen in der Gunst der Anleger und verzeichneten Zuflüsse von 965 Milliarden Euro (+19,0 %), so viel wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das ändert allerdings nichts daran, dass die meisten Sparer Versicherungen und Pensionen weiterhin verhalten gegenüberstehen. Anteilsmäßig flossen nur 23 % der frischen Spargelder in diese Vermögensklasse. In den Jahren und Jahrzehnten vor der Pandemie hatte ihr Anteil durchgängig bei über 40 % gelegen und teilweise sogar 50 % erreicht.
Anlageflüsse nach Vermögensklassen, in Billionen Euro (zum Euro-Wechselkurs Ende 2024)
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.
2 Aufgrund einer eingeschränkten Datenverfügbarkeit bezieht sich die folgende Analyse nur auf West- und Osteuropa, Nordamerika, Australien und Japan.
Die amerikanischen Sparer investieren auch ihre frischen Spargelder bevorzugt in Wertpapiere. Im Jahr 2024 flossen hier 67 % der neuen Ersparnisse in diese Vermögensklasse, verglichen mit einem Anteil von lediglich 26 % in Westeuropa (Abbildung 11). Die konsequente Konzentration der amerikanischen Sparer auf Anlageinstrumente mit hohem Wertzuwachspotenzial hat sich ausgezahlt. Während das Geldvermögen der westeuropäischen Haushalte in den letzten zehn Jahren nur um durchschnittlich 3,8 % pro Jahr gewachsen ist, haben es die nordamerikanischen Haushalte auf +6,2 % pro Jahr gebracht, obwohl die Sparanstrengungen in Europa größer waren: Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre erreichten die von den Sparern mobilisierten frischen Gelder hier 2,3 % des Bestandsvermögens, während es in den USA nur 2,0 % waren. Das starke Wachstum ihres Geldvermögens haben die US-Sparer vor allem Wertgewinnen zu verdanken. In den vergangenen zehn Jahren trugen Wertsteigerungen der Portfolios in den USA durchschnittlich 67 % zum jährlichen Vermögenswachstum bei – in Westeuropa waren es nur 35 %. Der Vergleich mit Deutschland ist aufschlussreich: Die deutschen Sparer haben in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls ein relativ hohes Vermögenswachstum erzielt (+5,9 % pro Jahr), allerdings auf andere Weise: Hier trugen frische Spargelder mit 3,7 % pro Jahr fast doppelt so viel zum bestehenden Geldvermögen bei wie in den USA. Der Beitrag von Wertzuwächsen war mit 32 % weniger als halb so groß wie in den USA. Dieser Vergleich verdeutlicht den Unterschied zwischen „harten“ und „cleveren“ Sparern.
Umgekehrt bedeutet dies: Wenn sie ihr Sparverhalten ändern würden, könnten die europäischen Sparer mit der gleichen Anstrengung deutlich höhere Renditen erzielen. Das Potenzial für Vermögenswachstum in Europa erscheint also noch lange nicht ausgeschöpft – es gibt noch viel Spielraum für Optimierungen (siehe Kasten „Kapital auf Sparflamme: Das unausgeschöpfte Potenzial der privaten Spargelder in Europa“).

Anteile der Vermögensklassen und Länder/Regionen an den gesamten Anlageflüssen in % (zum Wechselkurs Ende 2024)
Quellen: Eurostat, nationale Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Finanzverbände und statistische Ämter, IWF, LSEG, Allianz Research.

Kapital auf Sparflamme: Das unausgeschöpfte Potenzial der privaten Spargelder in Europa
Die privaten Haushalte in der Eurozone halten weiterhin einen überproportional großen Anteil ihres Geldvermögens in renditeschwachen, leicht liquidierbaren Anlageformen. Im Dezember 2024 hatten die privaten Haushalte in der Eurozone mehr als 10,8 Billionen Euro auf Bankkonten geparkt – damit war dieses Kapital weitgehend unproduktiv.
Wie die verteilungsbasierte Vermögensbilanz (Distributional Wealth Accounts, DWA) der EZB zeigt, halten selbst die wohlhabendsten Haushalte in der Eurozone mehr als die Hälfte ihres Geldvermögens in Bankeinlagen. Eine Ausnahme bildet nur das reichste Dezil, wo finanzielles Betriebsvermögen der größte Posten in der Finanzbilanz ist (Abbildung 12). Dieses konservative Sparverhalten hat sich über die Zeit als bemerkenswert beständig erwiesen, selbst angesichts einer steigenden Inflation und eines zunehmenden Bedarfs für eine langfristige Vorsorge. Es behindert sowohl den individuellen Vermögensaufbau als auch die Fähigkeit des europäischen Finanzsystems, privates Kapital in langfristige, wachstumsfördernde Investitionen zu lenken.
Portfoliostruktur nach Vermögensdezilen in der Eurozone in %
Quellen: EZB, Allianz Research.
Gesamtanstieg des Geldvermögens 2025-2034, Anteil am verfügbaren Einkommen 2034 in %
Quellen: EZB, Allianz Research.
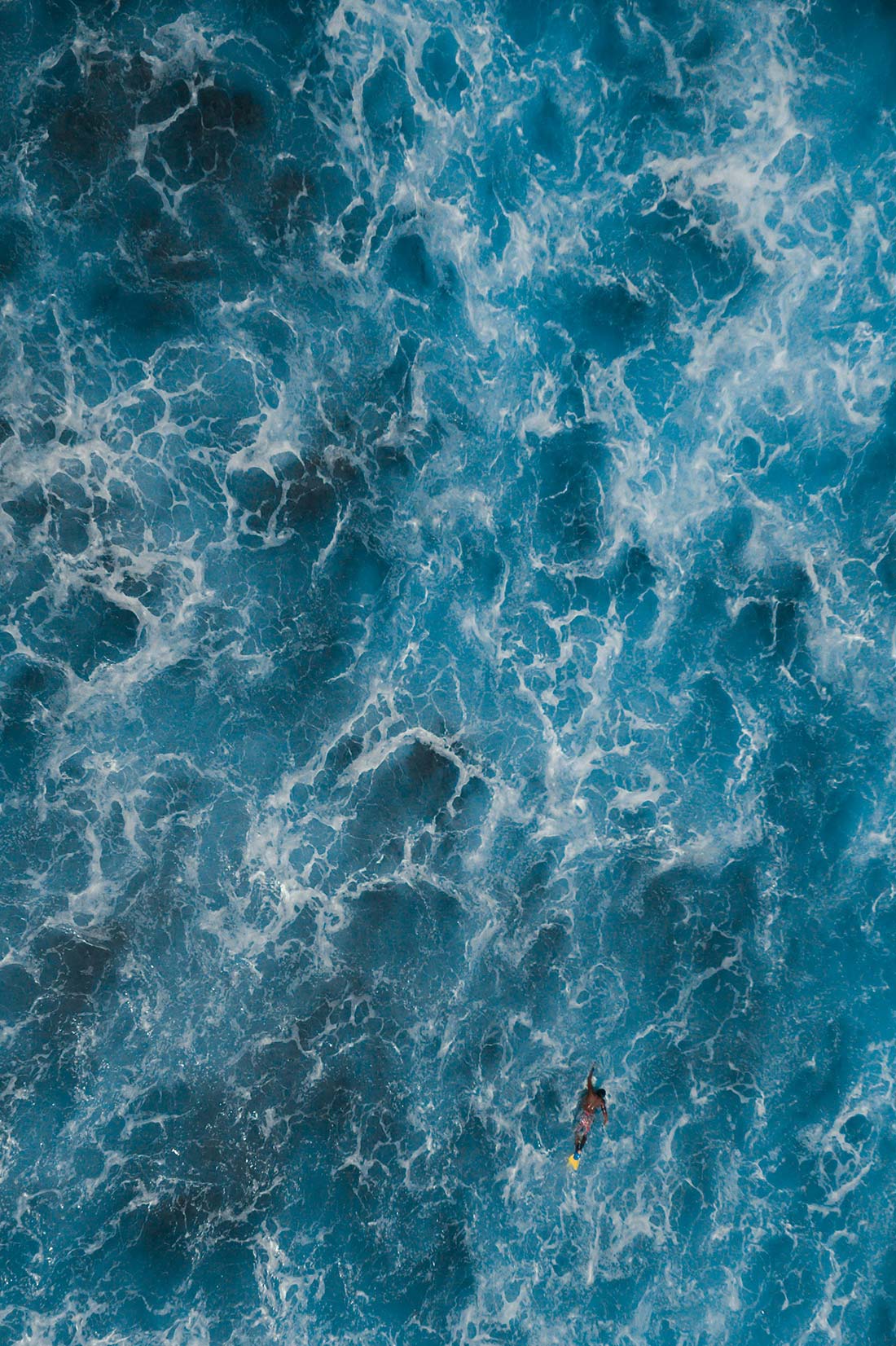
Ausblick
Das weltweite Geldvermögen wird 2025 voraussichtlich weiter wachsen, wenn auch nicht mehr mit dem gleichen Tempo wie in den beiden Vorjahren. Die Aktienmärkte haben ihren Aufwärtstrend trotz politischer Turbulenzen fortgesetzt, aber die Aktienbewertungen sind im historischen Vergleich hoch. Das gilt insbesondere für US-Aktien. Dementsprechend groß ist das Potenzial für einen Rückschlag, zumal die Auswirkungen der US-Handelspolitik erst in der zweiten Jahreshälfte voll zum Tragen kommen werden. Von geldpolitischer Seite ist wenig Unterstützung zu erwarten. In Europa sind die Zinsen bereits niedrig; in den USA bereitet die anhaltende Inflation der Fed weiterhin Kopfzerbrechen, zumal die Teuerung aufgrund der Zölle eher steigen als sinken dürfte. Daher sind erhebliche weitere Zinssenkungen auf beiden Seiten des Atlantiks keine Option, auch wenn die Wirtschaft vermutlich weiter an Fahrt verlieren wird. Die Unsicherheit in Bezug auf die Handelspolitik der USA überschattet auch die Anlage- und Sparentscheidungen. Dadurch dürften die Sparanstrengungen in diesem Jahr insgesamt etwas schwächer ausfallen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren gehen wir davon aus, dass das globale Geldvermögen im Jahr 2025 um rund 6 % wachsen wird.
Der mittelfristige Ausblick ist noch unsicherer, zumal noch völlig unklar ist, wie stark die künstliche Intelligenz (KI) Wirtschaft und Märkte in Zukunft prägen wird. Die Prognosen reichen von einer neuen Industriellen Revolution, die ein goldenes Zeitalter einläutet, bis hin zu lediglich marginalen Veränderungen, vergleichbar mit denen, die wir durch die „digitale“ Revolution bislang gesehen haben. So disruptiv die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Revolution auch sein mögen – in den Produktivitätsstatistiken hat sie bislang kaum Spuren hinterlassen. Wohin die Reise geht, werden wir vermutlich erst in einigen Jahren wirklich sagen können. Vorerst wird die aktuell hohe politische Unsicherheit auf nationaler wie auch internationaler Ebene die weitere Entwicklung bestimmen. Illusionen sind fehl am Platze: Eine fragmentierte Welt bedeutet weniger Wachstum und Rendite für alle. Vor diesem Hintergrund ist für die nächsten Jahre nur ein bescheidenes Wachstum des Geldvermögens von 4 % bis 5 % zu erwarten, bis uns die KI auf einen höheren Wachstumspfad katapultiert – falls sie es denn tut. Eines lässt sich jedoch mit relativer Sicherheit sagen: Die Volatilität wird weiter zunehmen. Die Launen der Politik dürften Wirtschaft und Märkte auf absehbare Zeit in Atem halten.







