Das Jahr 2024 war ein weiteres Jahr soliden Wachstums für die Weltwirtschaft – und ein weiteres Rekordjahr für das Geldvermögen privater Haushalte: Mit einem Anstieg um 8,7 % übertraf dieses das starke Wachstum des Vorjahres (+8,0 %). Ende 2024 belief sich das weltweite Geldvermögen auf einen neuen absoluten Rekordwert von 269 Billionen Euro. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung lag es mit 283 % jedoch nur auf dem Niveau von 2017, da die Inflation den Nenner „künstlich“ aufgebläht hat.
Allianz Global Wealth Report 2025:
Executive Summary
Volle Kraft voraus
Die USA halten ihre Spitzenstellung
Wie zu erwarten, ist dieser immense Wohlstand weltweit nicht gleich verteilt. Tatsächlich konzentriert sich das private Geldvermögen zu rund der Hälfte auf nur eine Region: Nordamerika. Bemerkenswert ist, dass sich deren Anteil in den letzten 20 Jahren kaum verändert hat – trotz des rasanten Aufstiegs Chinas. Der Anteil der chinesischen Haushalte am weltweiten Privatvermögen liegt nun bei etwa 15 % und hat sich damit seit 2004 verfünffacht. Chinas Aufstieg ist auf Kosten anderer entwickelter Regionen gegangen. So sind die Anteile Westeuropas und Japans am weltweiten Privatvermögen in den letzten zwei Dekaden deutlich um 9,1 beziehungsweise 5,9 Prozentpunkte geschrumpft. Japans Anteil hat sich damit mehr als halbiert.
Wachstum „Made in the USA“
In den letzten 20 Jahren sind die Finanzanlagen amerikanischer Haushalte im Einklang mit dem globalen Durchschnitt gewachsen. Im Jahr 2024 war ihr Wachstum sogar noch höher. Ganz anders sah es in Westeuropa und Japan aus: Hier blieb das jährliche Wachstum des Geldvermögens um mehr als 2 Prozentpunkte beziehungsweise knapp 4 Prozentpunkte hinter dem weltweiten Durchschnitt zurück. Zusammen mit der schieren Höhe des amerikanischen Geldvermögens bedeutet dies, dass 2024 mehr als die Hälfte (53,6 %) des globalen Vermögenswachstums auf Nordamerika entfiel. Im Durchschnitt der vergangenen zwei Jahrzehnte waren es 48,5%, während China und Westeuropa für 19,8 % beziehungsweise 14,1 % des Wachstums des globalen Geldvermögens verantwortlich waren. Was den finanziellen Wohlstand angeht, bleiben die USA der unangefochtene Spitzenreiter.
Tatsächlich konzentriert sich das private Geldvermögen zu rund der Hälfte auf nur eine Region: Nordamerika.


Clevere Sparer
Für das Vermögenswachstum ist der Besitz von Wertpapieren – insbesondere Aktien – von entscheidender Bedeutung. In den letzten beiden Jahren zahlte sich dieser besonders aus: Sowohl 2023 (+11,5 %) als auch 2024 (+12,0 %) wuchs das Wertpapiervermögen fast doppelt so schnell wie das der beiden anderen Vermögensklassen: Versicherungen/Pensionen (+6,7 % bzw. +6,9 %) und Bankeinlagen (+4,7 % bzw. +5,7 %). Aufgrund unterschiedlicher Portfoliostrukturen profitieren Sparer in verschiedenen Ländern und Regionen jedoch nicht in gleichem Maße von steigenden Wertpapierkursen. Auffällig ist, dass vor allem nordamerikanische Sparer Wertpapiere halten. Im Schnitt machen diese 59,2 % ihrer Portfolios aus. In Westeuropa dagegen sind es nur 34,9%.
Harte Sparer
Amerikanische Sparer investieren auch frische Spargelder bevorzugt in Wertpapiere, deren Anteil an den neuen Mittelzuflüssen im Jahr 2024 bei 67 % lag, verglichen mit lediglich 26 % in Westeuropa. Diese konsequente Konzentration der amerikanischen Sparer auf Anlageinstrumente mit hohem Wertzuwachspotenzial hat sich ausgezahlt. Während das Geldvermögen der westeuropäischen Haushalte in den letzten zehn Jahren nur um durchschnittlich 3,8 % pro Jahr gewachsen ist, haben es die nordamerikanischen Haushalte auf +6,2 % pro Jahr gebracht. Allerdings sind die Sparanstrengungen in Europa größer: Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre erreichten die von den Sparern mobilisierten frischen Gelder hier 2,3 % des Bestandsvermögens, während es in den USA nur 2,0 % waren. Ein Vergleich mit Deutschland ist aufschlussreich: Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls ein relativ hohes Vermögenswachstum verzeichnet (+5,9 % pro Jahr), allerdings auf andere Weise: Frische Spargelder trugen 3,7 % pro Jahr zum bestehenden Geldvermögen bei – fast doppelt so viel wie in den USA. Gleichzeitig betrug der Beitrag von Wertzuwächsen nur 32 % – weniger als halb so viel wie in den USA.
Keine weiteren Schulden bitte
Obwohl die Zentralbanken im Jahr 2024 begonnen haben, ihre Leitzinsen wieder zu senken, hat dies nicht zu einer höheren Nachfrage nach Krediten geführt. Tatsächlich hat sich das Schuldenwachstum der privaten Haushalte weiter verlangsamt – von +3,8 % im Jahr 2023 auf +3,1 %. Insgesamt beliefen sich die Schulden der globalen Privathaushalte Ende 2024 auf 59,6 Billionen Euro. Im Jahr 2024 fiel das Schuldenwachstum in fast allen Regionen schwach aus, wobei in China eine besonders deutliche Trendumkehr zu sehen war: Nachdem die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte hier in den vorhergehenden zwei Jahrzehnten um durchschnittlich fast +20 % pro Jahr gestiegen waren, nahmen sie im Jahr 2024 um lediglich 3,4 % zu.

Starker Anstieg des Nettogeldvermögens
Zusammen führten das relativ starke Wachstum des Geldvermögens und das relativ schwache Schuldenwachstum im Jahr 2024 zu einem deutlichen Anstieg des Nettogeldvermögens (Vermögenswerte minus Verbindlichkeiten). Mit +10,3 % überstieg dieser das starke Wachstum des Vorjahres (+9,4 %) nochmals deutlich. Insgesamt belief sich das globale Nettogeldvermögen Ende 2024 auf 210 Billionen Euro. Damit hat es sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Im vergangenen Jahr lag das Wachstum in fast allen Regionen deutlich über dem langfristigen Trend.
Schulden in aufstrebenden Ländern
Die globale Schuldenquote (Verbindlichkeiten im Verhältnis zum BIP) betrug 62,6 % und war damit fast 8 Prozentpunkte niedriger als vor zwei Jahrzehnten. Allerdings ist das Bild regional sehr unterschiedlich. Hinter dem Schuldenabbau der letzten 20 Jahre stehen vor allem die privaten Haushalte in Nordamerika (-15,9 Prozentpunkte), Japan (-6,1 Prozentpunkte) und Westeuropa (-2,5 Prozentpunkte). Die Schuldenquoten der meisten Schwellenländer sind dagegen in den letzten zwei Dekaden deutlich gestiegen, wobei China mit einem Anstieg um 43,4 Prozentpunkte auf 61,4 % an der Spitze steht. Hier zeigt sich ein klares Muster: In den Schwellenländern sind die Nettogeldvermögen deutlich langsamer gewachsen als die Bruttogeldvermögen, die Schulden also im Schnitt schneller gestiegen als die Vermögenswerte. In den Industrieländern ist die Entwicklung gegenläufig: Die Schulden wachsen langsamer als das Finanzvermögen.

Ein weiteres schwaches Immobilienjahr
Mit einer Rate von 3,6 % wuchs das weltweite Immobilienvermögen im Jahr 2024 mehr als doppelt so schnell wie im Vorjahr (1,7 %). Allerdings ist selbst diese Zahl historisch gesehen eher enttäuschend – noch langsamer wuchs das Immobilienvermögen nur im Jahr 2012, im Nachgang der globalen Finanzkrise. Die Preisentwicklung variierte jedoch von Markt zu Markt. Während in Nordamerika solide Wertsteigerungen verzeichnet wurden, bewegten sich die Preise in Westeuropa kaum. In einigen Märkten wie Frankreich und Deutschland sind die Preise sogar auf breiter Front gesunken. Insgesamt belief sich das Immobilienvermögen in den von uns analysierten Ländern auf 158 Billionen Euro.
Arme Länder holen nicht mehr auf
Was die weltweite Wohlstandsentwicklung angeht, war über viele Jahre ein Konvergenzprozess zu beobachten, durch den die Kluft zwischen ärmeren und reicheren Ländern kleiner wurde. Damit ist es vorbei, wie ein Blick auf die Entwicklung des Nettogeldvermögens der Industrieländer im Verhältnis zu dem der Schwellenländer zeigt. Von 2004 bis 2014 sank dieser Verhältniswert drastisch von 67 auf 24 – im Jahr 2014 war das Nettogeldvermögen der reicheren Länder also „nur“ noch 24 Mal so hoch wie das der ärmeren Länder. In den folgenden zehn Jahren ging dieser Wert jedoch nur noch um insgesamt 6 Punkte auf aktuell 18 zurück, wobei der Großteil dieses Rückgangs in den ersten zwei Jahren dieses Zeitraums – auf einen Wert von 20 im Jahr 2016 – stattfand. Seit 2017 ist die Konvergenz zwischen reicheren und ärmeren Ländern mehr oder weniger zum Stillstand gekommen.
Keine Fortschritte in 20 Jahren
Insgesamt scheint die Vermögensverteilung auf nationaler Ebene weniger ungleich zu sein als auf globaler Ebene. Auf nationaler Ebene entfallen 60,4 % des Gesamtvermögens der privaten Haushalte auf die reichsten zehn Prozent (ungewichteter Durchschnitt) – auf globaler Ebene sind es 85,1 %. Die Kluft zwischen Median- und Durchschnittsvermögen ist auf nationaler Ebene ebenfalls deutlich geringer, da das Pro-Kopf-Vermögen nicht 15 Mal, sondern nur etwa drei Mal so hoch ist wie das Medianvermögen (Verhältnis 3,08). In einer Hinsicht ist das Bild auf nationaler Ebene jedoch noch besorgniserregender: Obwohl Ungleichheit seit Jahren ein großes politisches Thema ist, hat es keine Fortschritte in Richtung einer ausgewogeneren Vermögensverteilung gegeben. Im Jahr 2004 besaßen die reichsten zehn Prozent der Haushalte in den von uns analysierten Ländern im Schnitt 59,9 % des gesamten Geldvermögens und das durchschnittliche private Vermögen lag beim Dreifachen des Medianwerts (Verhältnis 3,05). Diese Zahlen sind fast identisch mit denen für 2024.
Seit 2017 ist die Konvergenz zwischen reicheren und ärmeren Ländern mehr oder weniger zum Stillstand gekommen.
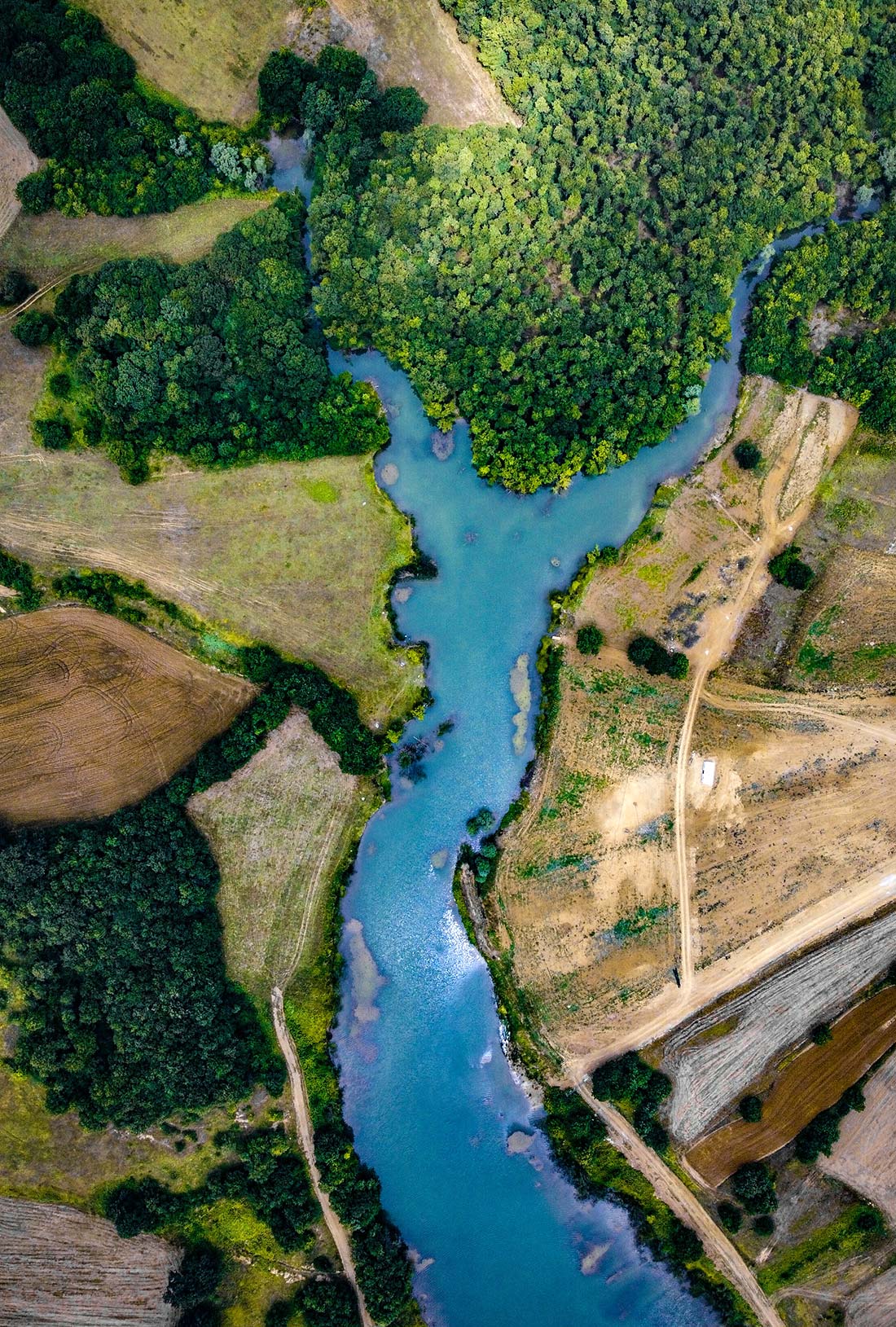
Chinas „wilde“ Jahre sind vorbei
In einigen Ländern sind Veränderungen erkennbar, allerdings nur in wenigen. Von 57 betrachteten Ländern weisen 37 eine relativ stabile Vermögensverteilung auf: Die Vermögenskonzentration – der Anteil der obersten zehn Prozent am Gesamtvermögen – hat sich um weniger als 2 Prozentpunkte verändert. Nur in sieben Ländern hat sich die Vermögensverteilung durch eine verringerte Vermögenskonzentration verbessert, während die Vermögenskonzentration in 13 Ländern deutlich zugenommen hat. China sticht dabei besonders hervor. Nirgendwo sonst ist der Vermögensanteil der reichsten zehn Prozent so stark gestiegen wie hier (+17,3 Prozentpunkte). Grund dafür ist die tiefgreifende wirtschaftliche und soziale Transformation des Landes in den letzten 20 Jahren. Diese hat nicht nur zu einem enormen allgemeinen Wohlstandszuwachs beigetragen, sondern auch zur Entstehung einer echten Oberschicht. Mit 67,9 % liegt der Anteil der reichsten zehn Prozent am Gesamtvermögen in China jetzt deutlich über dem globalen Durchschnitt. Allerdings scheinen Chinas „wilde“ Jahre vorbei zu sein – in den letzten fünf Jahren ist die Vermögenskonzentration hier unverändert geblieben.








