Es ist an der Zeit, sich gegen Polarisierung zu vereinen
Die Polarisierungsforschung unterscheidet verschiedene Arten der Polarisierung, wobei die ideologische Polarisierung die wohl bekannteste ist: Entfernen sich zwei politische Lager in ihren Ansichten zunehmend voneinander, dann spricht man von wachsender ideologischer Polarisierung. Das ist grundsätzlich nicht problematisch, eine Demokratie lebt von Meinungsvielfalt. Kritisch wird die ideologische Polarisierung dann, wenn sich die politischen Lager über mehrere Themenbereiche hinweg voneinander abgrenzen.
Für Deutschland zeigen Studien zur ideologischen Polarisierung ein differenziertes Bild: Im Zeitraum von 1980 bis 2010 hat die politische Lagerbildung abgenommen. Bei Einstellungen zu Themen wie der Migration, Homosexualität oder Ungleichheit herrscht in der Mitte der deutschen Gesellschaft Einigkeit - trotz radikaler Randgruppen.
Ist das Bild einer gespaltenen Gesellschaft in Deutschland also übertrieben? Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick über den deutschen Tellerrand hinaus. Die internationale Forschung betont zunehmend die Bedeutung einer zweiten Form der Polarisierung: die affektive Polarisierung. Sie beschreibt, wie stark Menschen andere politische Gruppen emotional ablehnen oder ihnen misstrauen.
Diese Form der Polarisierung hat sich besonders in den USA seit den 1970er Jahren fast verdoppelt, aber auch in europäischen Ländern wie Frankreich oder der Schweiz deutlich verstärkt. Die Auswirkungen der affektiven Polarisierung sind weitreichend: Daten aus den USA zeigen, dass Menschen potenzielle Partner mit anderer politischer Ausrichtung ähnlich stark ablehnen wie solche mit anderem Bildungsniveau. In Umfragen gibt jeder zweite Anhänger der Republikaner an, unglücklich zu sein, falls das eigene Kind einen Anhänger der Demokraten heiraten sollte.
Die Forschung zur affektiven Polarisierung in Deutschland steht erst am Anfang. Studien kommen zu dem Schluss, dass die affektive Polarisierung in Deutschland auf einem vergleichbaren Niveau ist, wie in anderen westlichen Demokratien, wie Frankreich, Österreich oder den USA.
Die Messung in Deutschland wird dadurch erschwert, dass sich die Parteienlandschaft in den vergangenen Jahrzehnten stetig verändert hat. Unsere Analyse des monatlich erhobenen Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen legt nahe, dass diese Veränderungen der Parteienlandschaft eine wichtige Rolle für die Entwicklung der affektiven Polarisierung in Deutschland spielen. Sie zeigen auch, dass die affektive Polarisierung in Deutschland stetig gewachsen ist.
Seit den siebziger Jahren misst die Forschungsgruppe Wahlen, wie die deutschen Wähler ihre eigene und andere Parteien bewerten. Demnach hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Schere geöffnet. Während sich die positiven Bewertungen für die eigene Partei seit 1980 auf einem konstant hohen Niveau bewegen, sanken die Bewertungen der ideologisch am weitesten entfernten Partei im Bundestag kontinuierlich ab. Seit den Achtzigerjahren hat sich der Wert der affektiven Polarisierung nach dieser Messung um mehr als 60 Prozent erhöht. In der gleichen Zeit rückten die Wähler der SPD und der CDU/CSU emotional zusammen.
Das ist also der etwas nuanciertere Befund, wenn man ideologische und affektive Polarisierung zusammen betrachtet. Es stimmt zwar: Die politische Mitte ist sich in wichtigen politischen Fragen insgesamt einiger geworden. Doch zwischen der politischen Mitte und dem Rand, aktuell vor allem zur AfD, gibt es wesentlich mehr negative Gefühle als früher. Hier hat sich die Gesellschaft tatsächlich gespalten.
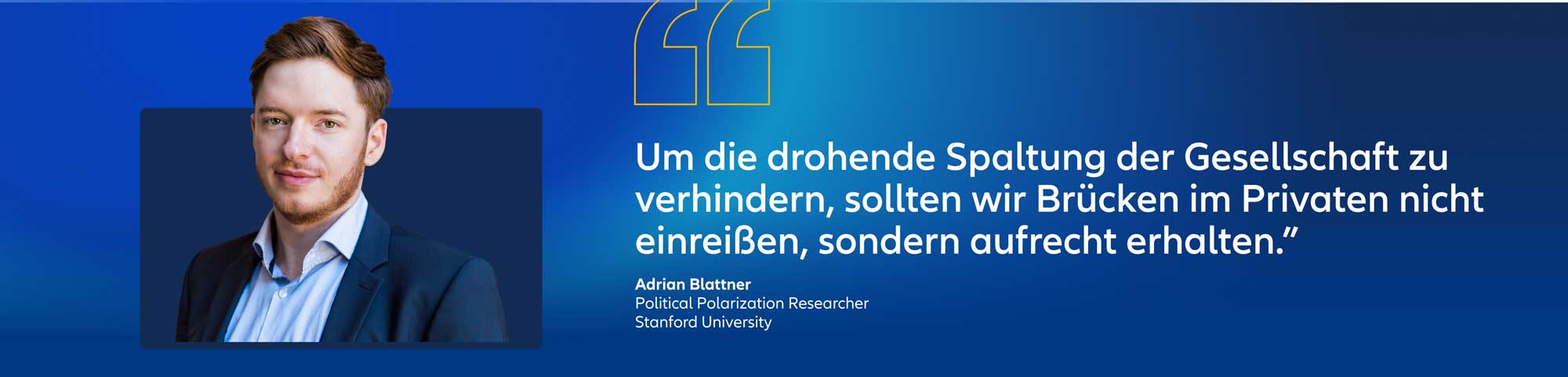
Das schlägt sich mittlerweile auch in den sozialen Beziehungen in Deutschland nieder. In unserer Analyse der Initiative „Deutschland Spricht“ von ZEIT-ONLINE gaben drei von vier Befragten an, weder Arbeitskollegen noch Familienmitglieder oder Freunde zu haben, die die Partei unterstützen, die sie am meisten ablehnen. Am stärksten isoliert war dabei die AfD.
Das Ergebnis solcher Abgrenzung können teils absurde Vorurteile gegenüber politischen Gegnern sein, wie sich in den USA zeigt: In einer 2018 veröffentlichten Studie überschätzten Republikaner den Anteil schwuler, lesbischer, oder bisexueller Demokraten um das Fünffache. Beide Seiten stufen zudem die Gegenseite deutlich gewaltbereiter ein, als diese tatsächlich ist. Diese verzerrten Wahrnehmungen verstärken die Abneigung und erschweren den Dialog. Ein Teufelskreis.
Die Folgen affektiver Polarisierung sind auch am Arbeitsplatz spürbar. Eine Studie aus Brasilien zeigt, dass Firmenbesitzer dort Anhänger der eigenen Partei in Einstellungsverfahren, bei Beförderungen und selbst bei der Entlohnung bevorzugt behandeln. Daten einer Studie aus den USA legen nahe, dass Demokraten und Republikaner Arbeitsplätze bevorzugen, die ihnen ideologisch näherstehen und dafür sogar bereit sind, Lohneinbußen hinzunehmen.
Ist eine solche Entwicklung auch in Deutschland zu erwarten? Dagegen spricht, dass das politische System in den USA anders funktioniert als in Deutschland. In den USA verläuft der politische Graben zwischen Republikanern und Demokraten quer durch die Gesellschaft. In Deutschland erwächst die affektive Polarisierung gegenüber mehreren, bislang eher kleinen Parteien.
Andererseits kann das Ende der Volksparteien in Deutschland auch bedeuten, dass der Anteil der Parteien wächst, denen wiederum andere große Teile der Bevölkerung mit großer Abneigung gegenüberstehen. Vor der Bundestagswahl im Februar 2025 liegt die AfD mit rund 20 Prozent vor der einstigen Volkspartei SPD. Auch deshalb lohnt es sich, die Mechanismen zu verstehen, die zu affektiver Polarisierung führen.
Welche Faktoren für die steigende affektive Polarisierung verantwortlich sind, ist eine viel diskutierte Frage. Im Fall der USA gilt als einer der Gründe, dass Wähler sich heute weitaus stärker mit einer Partei identifizieren als früher. Die Partei ist nicht nur politische Heimat, die Wahlentscheidung wird Teil der eigenen Identität.
Ein zweiter Trend ist auf die Parteien selbst zurückzuführen. Nehmen Parteien intern immer homogenere Positionen ein und distanzieren sich inhaltlich deutlich von anderen Parteien, so fördert dies auch die affektive Polarisierung. Bedienen sich zudem große Teile der Parteieliten einer spaltenden Rhetorik, kann das zu einem vergifteten politischen Klima beitragen.
Der dritte Trend betrifft die Medien. Forscher argumentieren, dass die Einführung von privaten Nachrichtensendern mit starker politischer Gesinnung einen Beitrag zur Polarisierung des öffentlichen Diskurses in den USA geleistet hat. Auch über die Rolle von sozialen Medien wird viel diskutiert. Jüngste Untersuchungen in den USA zeigen, dass der Einfluss der Algorithmen und sogenannter Echokammern auf die Polarisierung deutlich geringer ausfällt als oft befürchtet.
Auch in Deutschland setzen sich die Wählerschaften der Parteien aus bestimmten demographischen Gruppen zusammen. Die Grünen erzielen bessere Ergebnisse in Städten, während die AfD deutlich besser in ländlichen Wahlkreisen und im Osten abschneidet. Allerdings ist die Wählerschaft bei weitem nicht so segregiert wie in den USA.
Auch die Polarisierung der Medienlandschaft ist in Deutschland nicht im selben Maße vorangeschritten wie in den USA. Ähnlich wie in Großbritannien konsumiert eine breite Mehrheit in Deutschland regelmäßig Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Jedoch zeichnet sich auch in Deutschland ein Rückgang des Vertrauens gegenüber Nachrichtenangeboten ab. Eine offene Frage bleibt, welchen Einfluss neue Plattformen wie TikTok auf den politischen Prozess in Deutschland und auch weltweit nehmen werden.
Um eine Spaltung unserer Gesellschaft zu verhindern, kann die Politik einen rechtlichen Rahmen setzen, etwa bei der Verbreitung von Falschmeldungen. Staatliche Förderungen sind ein wichtiges Instrument, um den Zugang zu demokratischer Bildung und politisch unabhängigen Nachrichten zu stärken. Auch können Politiker selbst ein Zeichen setzen, indem sie spaltende Rhetorik in ihren eigenen Reihen ächten und Raum für abweichende politische Standpunkte innerhalb ihrer Parteien schaffen.
Staatliche Regulierung ist jedoch nur ein Werkzeug, um die drohende affektive Polarisierung zu begrenzen. Auch zivilgesellschaftliche Organisationen leisten einen wichtigen Beitrag. In Deutschland, den USA, und vielen weiteren Ländern wurden Organisationen mit dem Ziel gegründet, Menschen mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen für Gespräche zusammenzubringen, um Brücken über politische Gräben hinweg zu schlagen. Unsere Analyse der Initiative „Deutschland Spricht“ deutet darauf hin, dass solch ein Austausch zwischen politischen Gegnern die affektive Polarisierung reduzieren kann.
Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist, die Reichweite sozialer und traditioneller Medien zu nutzen, um Vorurteile abzubauen und friedlichen politischen Austausch sichtbarer zu machen. Bei einem Wettbewerb reichten mehr als 400 Wissenschaftlerinnen Ideen ein, wie man affektive Polarisierung bekämpfen kann. Das Ergebnis: Am besten schnitt ein Werbespot ab, in dem eine Gruppe von Britinnen erst gemeinsam eine Bar zusammenbauen und anschließend ihre politischen Unterschiede bei einem Bier diskutieren.
Eine zentrale Frage für die Zukunft bleibt, wie Demokratie fördernde Programme einer breiteren Masse zugänglich gemacht werden können. Dazu bedarf es nachhaltiger Finanzierung, aber auch der Bereitschaft von Bildungseinrichtungen und Firmen, solche Angebote im Rahmen institutioneller Kooperationen zu unterstützen. Laut aktueller Studien gibt es einen wichtigen Anreiz: Eine gesunde Demokratie ist gut fürs Geschäft.
Nicht zuletzt erfordert eine erfolgreiche Antwort auf die drohende Spaltung der Gesellschaft eine Antwort auf individueller Ebene. Dazu gehört, Brücken im Privaten nicht einzureißen, sondern aufrecht zu erhalten. Noch hat sich die deutsche Gesellschaft nicht so weit gespalten, dass der in einer gesunden Demokratie notwendige Austausch zwischen den politischen Lagern ausbleibt. Und doch wäre es falsch, das Problem zu unterschätzen. Jetzt ist die Zeit, sich gemeinsam dagegen zu wenden.
Über Adrian Blattner
Über die Allianz
Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 761 Milliarden Euro*. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,9 Billionen Euro* für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2024 erwirtschafteten über 156.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 179,8 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 16,0 Milliarden Euro.
* Stand: 30. September 2025.





